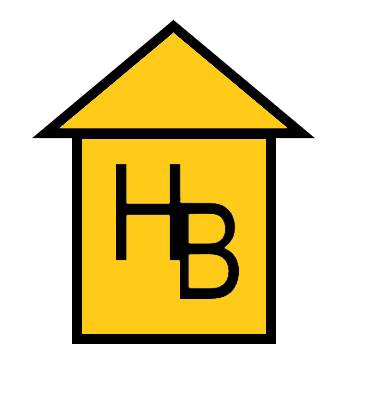Allgemeines zu Schimmelpilzen

Pilzbefall in Wohnräumen stellt einen erheblichen Mangel dar und kann stark gesundheitsgefährdend sein. Er wird üblicherweise durch schwarze oder grünliche Flecken auf der Oberfläche wahrgenommen, kann aber unterschiedliche Farben aufweisen. Stockflecken entstehen durch Pilzbefall und sind als solche zu behandeln. Pilze sind überall in der Luft, auf bzw. in Körpern anzutreffen. Es sind viele Tausend verschiedene Pilzarten bekannt. Nur etwa 200 Pilzarten sind im Baubereich anzutreffen. Es scheint müßig zu sein, eine bestimmte Pilzart feststellen zu lassen, die Kosten sind zu hoch. Pilze brauchen zum Leben kein Licht, sondern nur Feuchtigkeit und einen organischen Kohlenstoffnährboden. Staub auf der Bauteiloberfläche ist bereits ein Nährboden. Pilze können sich nicht aktiv fortbewegen. Sie vermehren sich durch Sporen. Die Sporen wiederum können durch die Luft bzw. Staub verbreitet werden. Der Ausdruck „Schimmel“ gilt allgemein für oberflächig wachsende Pilzgeflechte. Pilze lassen sich abtöten. Dies ist jedoch kein Ersatz für eine richtige und vernünftige Baukonstruktion oder für entsprechendes Heizen und Lüften innerhalb von Räumen. Der Pilzbefall tritt nicht erst mit der Taupunkterreichung (100% rel. Luftfeuchte) ein, sondern der Pilz kann sich bereits bei niedrigerer relativer Raumluftfeuchte auf der raumseitigen Bauteiloberfläche vermehren.
Grundlegend zu beachten
Bei einer Dauerlüftung, z. B. durch gekippte Fenster, kann die Oberfläche so stark abkühlen, dass die rel. Luftfeuchtigkeit in diesem Bereich über 80% ansteigen kann und sich ein Pilzbefall dort ausbreitet.
Ein Wachstum von Schwärze- oder Schimmelpilzkulturen kann schon bei folgenden Voraussetzungen vorliegen:
- eine Tauwasserperiode von über 3 Tagen,
- eine Temperatur von min. 12°C und
- eine relative Luftfeuchte von über 70%.
Für einen Pilzbefallnachweis sind nach DIN 4108-2, Absatz 6 folgende Werte anzusetzen:
- Rse 0,04
- Rsi 0,25 für beheizte Räume
- Raumluftfeuchte 50%
- Raumtemperatur 20°C
- Außentemperatur minus 5°C .
Grund: Die raumseitige Oberflächentemperatur eines Außenbauteils muss unter den Vorgaben nach DIN 4108 mindestens 12,6°C betragen.
 Eine andere Voraussetzung kann nach dem Temperaturfaktor fRsi an der ungünstigsten Stelle, hier Wand, Raumecke, Decken-Wandanschluss etc. nachgewiesen werden. Der fRsi-Faktor muss mindestens ≥ 0,7 nach der Formel (Twi-Ta)/(Ti-Ta) betragen.
Eine andere Voraussetzung kann nach dem Temperaturfaktor fRsi an der ungünstigsten Stelle, hier Wand, Raumecke, Decken-Wandanschluss etc. nachgewiesen werden. Der fRsi-Faktor muss mindestens ≥ 0,7 nach der Formel (Twi-Ta)/(Ti-Ta) betragen.
Twi bedeutet die Temperatur auf der raumseitigen Außenwand, Ti = Raumlufttemperatur, Ta Außenlufttemperatur.
Die Mindesttemperatur auf der saugfähigen Oberfläche (Raumseite) darf hiernach 12,6°C nicht unterschreiten. Die vorgegebene Raumluftfeuchtigkeit von 50% wird hierbei auf 80% rel. Luft-feuchte vor dem Außenbauteil ansteigen.
Nach der Literatur soll sich im Regelfall bis 80% rel. Luftfeuchtigkeit auf der Oberfläche eines Außenbauteiles allgemein noch kein Pilzbefall ausbreiten.
Dieser Hinweis gilt auch für die Raumecken! Hier darf die Oberflächentemperatur auch nicht unter 12,6°C fallen, ansonsten wäre mit einem Pilzbefall oder bei noch tieferen Temperaturen und bei Unterschreitung des sogenannten Taupunktes mit Tauwasser zu rechnen.
Berechnungen
Um einen Pilzbefall auf Bauteiloberflächen zu vermeiden wurden einige Programme entwickelt, die eine Ausrechnung erleichtern.
Wie groß muss eine Mindesttemperatur im Allgemeinen auf der raumseitigen Außenwand etc. sein, ohne dass sich Tauwasser bildet? Zuerst sollte man den Sättigungsdampfdruck von Ti errechnen. Hier sind mehrere Formelanwendungen möglich. (Ti ist die Raumlufttemperatur). Für die Berechnung der Dampfdrücke PS kann die Formel nach der DIN 4108 verwandt wer-den. Zu unterscheiden ist jedoch die Temperatur von -20°C bis 0°C und von 0°C bis 30°C.
In anderen Formeln sind größere Temperaturspreizungen vorhanden, (siehe BAUPHYS Programm 010-7).
Nach DIN 4108 kann die nachstehende Formel-Kombination eingegeben werden:
PS = WENN(Ti<0;4,689*(1,486+Ti/100)^12,3;288,68*(1,098+Ti/100)^8,02
Die raumseitige Mindestoberflächentemperatur der Außenwand ist abhängig von Ti und der rel. Raumluftfeuchte. Diese erforderliche Mindesttemperatur (Taupunkttemperatur) kann mit einem BAUPHYS Programm berechnet werden.
Beispiel: Vorgaben: PS = 2.340, rel. Luftfeuchte = 50%. PS ist hierbei der Sättigungsdampfdruck von der Raumtemperatur, LF die rel. Raumluftfeuchte in %. Formel: (237,3*LN((PS * rel. LF)/610,5))/(17,269-LN((PS*rel. LF)/610,5)) Ausrechnung: (237,3*LN((2340*50%)/610,5))/(17,269-LN((2430*50%)/610,5)) = 9,3°C
Die Taupunkttemperatur gibt an, bei welcher Temperatur die rel. Luftfeuchtigkeit 100% erreicht.
Berechnungen um Schimmelpilzbefall zu vermeiden
Um einen Schimmelpilzbefall auf Flächen zu vermeiden, kann nach der Formel:
(109,8+Ti)*(rel. Luftf./0,8)^0,1247-109,8
die erforderliche Mindesttemperatur auf der raumseitigen Oberfläche eines Bauteils errechnet werden. Die rel. Raumluftfeuchte wird hier in einer Dezimalzahl, die max. rel. Luftfeuchte auf der Fläche gleichfalls in einer Dezimalzahl angegeben.
In anderen Formeln sind größere Temperaturspreizungen vorhanden, (siehe BAUPHYS Programm 010-7).
Nach DIN 4108 kann die nachstehende Formel-Kombination eingegeben werden:
PS = WENN(Ti<0;4,689*(1,486+Ti/100)^12,3;288,68*(1,098+Ti/100)^8,02
Die raumseitige Mindestoberflächentemperatur der Außenwand ist abhängig von Ti und der rel. Raumluftfeuchte. Diese erforderliche Mindesttemperatur (Taupunkttemperatur) kann mit einem BAUPHYS Programm berechnet werden.
Beispiel: Vorgaben: PS = 2.340, rel. Luftfeuchte = 50%. PS ist hierbei der Sättigungsdampfdruck von der Raumtemperatur, LF die rel. Raumluftfeuchte in %. Formel: (237,3*LN((PS * rel. LF)/610,5))/(17,269-LN((PS*rel. LF)/610,5)) Ausrechnung: (237,3*LN((2340*50%)/610,5))/(17,269-LN((2430*50%)/610,5)) = 9,3°C
Die Taupunkttemperatur gibt an, bei welcher Temperatur die rel. Luftfeuchtigkeit 100% erreicht.
weitere Berechnungsbeispiele
Beispiel 1) relative Raumluftfeuchte 50%, die max. relative Luftfeuchte auf der Fläche mit 80%, Raumtemperatur 20°C Oberflächenmindesttemperatur ohne Pilzbefall = (0,50/0,80)^0,1247*(109,8+20)-109,8 = 12,6°C. Beispiel 2) relative Raumluftfeuchte 55%, die max. zulässige relative Luftfeuchte vor der Außenwand 75%, Raumtemperatur 16°C Oberflächenmindesttemperatur ohne Pilzbefall = (0,55/0,75)^0,1247*(109,8+16)-109,8 = 11,2°C. Beispiel 3) relative Raumluftfeuchte 60%, vor der Außenwand 80%, Raumtemperatur 23,5°C Oberflächenmindesttemperatur ohne Pilzbefall = (0,6/0,8)^0,1247*(109,8+23,5)-109,8 = 18,8°C
Die in der DIN 4108-2, Absatz 6 enthaltene Formel bezüglich der Mindesttemperatur bezieht sich, bei einem Übergangswiderstand Rsi nur auf beheizte Räume. Auch die Vorgaben von Ta = -5°C, Ti = 20°C und die rel. Luftfeuchte von 50% sind nur eine Vorgabe für diesen Fall. Andere rel. Feuchte und auch Temperaturen kommen in der Praxis vor. Denken Sie an Schlafzimmer etc. hier liegt die mittlere Temperatur allgemein bei 16°C, in Wohnräumen bei 22°C bis 24°C.
Auch die relative Luftfeuchte in den Räumen ist sehr unterschiedlich, in Schlafzimmern kann diese über 60% ansteigen. Sind Aquarien vorhanden, so ist die Wasserverdunstung zusätzlich anzurechnen.
Pilzbefall in Raumecken
Dieses Thema sollte nochmals angesprochen werden. Freie Raumecken im Bereich von Haus-ecken werden als geometrische Wärmebrücken bezeichnet. Im Bereich der raumseitigen Ecke (zwei aneinander stoßende Wände) liegt außen eine größere Abkühlfläche gegenüber. Aus diesem Grunde ist die Temperatur im Eckbereich geringer.
Entsprechend der Faustformel TEcke = Ti – 2* ΔT wird die Temperatur in der Ecke berechnet, wobei ΔT die Differenz zwischen der Raumtemperatur und der raumseitigen Wand bezeichnet.
Beispiel: Ti = 20 °C, Twi = 17 °C TEcke = Ti-2*(Ti - Twi) = 14 °C
Die Raumecktemperaturen lassen sich mit einem Infrarotmessgerät schnell und auch sicher feststellen. Da die gemessenen Temperaturen im Regelfall nicht den Vorgaben nach DIN 4108 entsprechen, ist zuvor eine Umrechnung auf diese Vorgaben vorzunehmen.
Vergleichende Hinweise:
Hierzu gibt es in BAUPHYS gleichfalls 2 Rechenprogramme. Das Rechenprogramm B1 (siehe BAU-PHYS Programm 041-83) hat im Ergebnis die gleichen Werte wie die z.B. die Berechnungen nach Schild, Eichler und Bläsi.
Die Formel nach B2 (siehe BAUPHYS Programm 041-83) entspricht in etwa den Ausrechnungen nach Hauser bzw. nach ARGOS.
Die Gegenüberstellungen der verschiedenen Programmausrechnungen sind auf dem BAU-PHYS Programm 041-83 nachzulesen.
Im Ergebnis sind die Ausrechnungen geringfügig niedriger. Dadurch ist eine höhere Sicherheit gegeben. Zu bedenken ist auch die geringere Luftzirkulation in Ecken.
Prof. Hauser hat u. a. einen Wärmebrückenatlas herausgebracht. Die dort entsprechend er-rechneten Mauern mit den (Raum-) Ecken können auch z.B. über das Programm ARGOS nachgerechnet werden. Geringfügige Differenzen sind hierbei zu tolerieren.
Fogging
Bei Fogging können sich die Oberflächen von Decken- und Wandbauteilen (schwarz) verfärben. Dieser Hinweis wird hier nicht näher erläutert. Über das relativ neue Thema Fogging wurde von Herrn Heinz-Jörn Moriske ein Buch verfasst.
Fogging ist nicht mit dem Schwärzepilz zu verwechseln. Die Entstehung von Fogging kann auf Weichmacher, die bei Produkten als Zusatz beigegeben werden, zurückgeführt werden. Ein Sachverständiger wird daher das Bauteil auf Feuchtigkeit hin überprüfen müssen. Als Ergänzung sind entsprechende bauphysikalische Berechnungen notwendig.